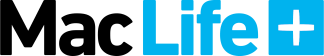Die Dokumentation mit dem Titel „Steve Jobs: The Man In The Machine“ hat es, anders als „Steve Jobs“ mit Michael Fassbender, nicht in die deutschen Kinos geschafft. Dafür ist die Dokumentation jetzt auch im deutschen iTunes Store zu sehen und wirft die Frage auf: Wie viele Jobs-Filme sind eigentlich genug?
Nach dem Tod von Steve Jobs 2011 überschlugen sich die Ereignisse. Hastig, vielleicht sogar überhastet, wurde die offizielle Biografie von Walter Isaacson veröffentlicht. Ein Buch, das selbst mehr „Biopic“ denn Dokumentation ist und viele Ungenauigkeiten enthält. Obwohl, vielleicht aber auch weil Steve Jobs selbst daran mitgewirkt hat.
Schon 2013 erschien dann der Spielfilm „Jobs“ mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle. Dass der Film insgesamt nur mittelmäßige Kritiken erntete, lag jedoch nicht an Kutcher, an dessen Qualifikation im Vorfeld viele zweifelten. Der Film war einfach nicht gut genug produziert und sparte entscheidende Momente aus, die für die persönliche Entwicklung von Jobs sicherlich wichtig waren.
In diesem Jahr folgte dann der quasi offizielle Steve-Jobs-Film unter dem Namen „Steve Jobs“. Als offiziell gilt er deshalb, weil Sony Pictures die Filmrechte an Isaacsons Buch erwarb. Neben Hauptdarsteller Michael Fassbender waren weitere namhafte Künstler involviert: Kate Winslet und Seth Rogen in weiteren Rollen, Aaron Sorkin (Screenplay) und Danny Boyle als Regisseur. „Steve Jobs“ ist deutlich besser produziert als „Jobs“, bedarf als Spielfilm aber einer ganz eigenen Dramaturgie und eines echten Helden.

Nun also der dritte Film innerhalb kürzester Zeit. Warum sollte man sich diesen Film auch noch anschauen? Kennt man nicht schon alles?
Zwei Stunden sind nicht genug
Ja, irgendwie kennt man schon alles. Trotzdem lohnt sich Alex Gibneys Dokumentation. Denn „Steve Jobs: The Man In The Machine“ ist als Dokumentation ein krasser Gegenpunkt zu den vorgenannten Hollywood-Hochglanz-Produktionen.
Obwohl die Dokumentation satte zwei Stunden lang ist, kommt sie jedoch nie zur Ruhe und wirkt in großen Teilen gehetzt. Um das Phänomen Steve Jobs erklären zu können, muss man eben viel zeigen und erzählen.
Gibneys Film lässt sich in zwei Hälften teilen. Er nutzt die erste Stunde, um den Zuschauer vorzubereiten. Hier geht es vornehmlich um den Gründungs-Mythos von Apple und Jobs’ erste Zeit an der Konzern-Spitze, bevor die Erzählung eine Abzweigung nimmt und sich mit dem Menschen Steve Jobs beschäftigt. Besser als den beiden Biopics gelingt es Gibney zu erklären, warum Jobs so geworden ist, wie er eben geworden ist.
Gibney spart in seiner Dokumentation nicht mit Kritik am Menschen Steve Jobs, entfernt sich so aber auch von einer neutralen Position.
Die zweite Hälfte des Films befasst sich jedoch fast ausschließlich mit den negativen Aspekten von Jobs’ späterem Wirken: Das schwierige Verhältnis zu seiner Tochter Lisa, die er über Jahre verleugnete, der Aktienskandal, seine Art, mit Menschen umzugehen, die Selbstmordserie bei Foxconn.
Kein eigenes Bild möglich
Wie in jeder guten Dokumentation überlässt Gibney das finale Urteil über Steve Jobs dem Zuschauer. Um wirklich qualifiziert urteilen zu können, bietet er gerade im Vorfeld uninformierten Zuschauern jedoch zu wenig Material. Neben Interview-Ausschnitten von Steve Jobs selbst kommen vor allem ehemalige Mitarbeiter und Journalisten zu Wort, die irgendwann einmal mit Jobs zu tun hatten. Wenig überraschend fehlen Statements von aktuellen Apple-Führungskräften und seiner Familie.
Besonders interessant sind Versatzstücke aus einer Anhörung Steve Jobs’ vor der „U.S. Securities and Exchange Commission“ (etwa vergleichbar mit der hiesigen Börsenaufsicht) aus dem Jahr 2008. Jobs sieht sich diversen unbequemen finanztechnischen Fragen gegenüber und fühlt sich dabei sichtlich unwohl. Sowohl geistig wie auch körperlich. Hier fehlt ganz klar eine zeitliche Einordnung durch Gibney. Denn für jemanden, der nicht weiß, dass Steve Jobs zu dieser Zeit bereits mit dem Krebs kämpfte und vermutlich körperliche Schmerzen zu erdulden hatte, wirkt der in seinem Stuhl hin und her wippende Jobs bestenfalls befremdlich.
Gerade aber mit dem Wissen um die schwere Erkrankung Jobs’ verbietet sich die Verwendung dieses Materials zur Untermauerung von Gibneys Thesen jedoch eigentlich. Denn rückblickend ist nichtmal klar, ob Jobs zu diesem Zeitpunkt überhaupt in der Lage war, korrekt zu antworten oder ob er die Befragung bloß schnell hinter sich bringen wollte und es ihm deshalb nicht so wichtig war, was er erzählte.
Warum trauert die Welt um Steve Jobs?
Das ist Gibneys zentrale Frage und mit ihr beginnt und endet der Film. Während es „The Man In The Machine“ stellenweise gut gelingt, die schlechten Seiten von Steve Jobs aufzuzeigen, fehlt der Dokumentation ein klares inhaltliches Gegengewicht abseits von Fans, die in Kameras beteuern, wie sehr sie Steve Jobs verehren.
Vielleicht war es aber auch Gibneys Absicht, seine Dokumentation gegenüber den Hollywood-Produktionen klar zu positionieren. Der geneigte Zuschauer muss sich so aber eigentlich alle drei Filme zu Gemüte führen, um ein einigermaßen rundes Bild zu erhalten.
In Deutschland ist der bislang wohl beste Film über die frühe Zeit im Silicon Valley unter dem Titel „Die Silicon Valley Story“ zu finden. Der Fernsehfilm von 1999 basiert auf dem Buch „Fire in the Valley: Making of the Personal Computer“ von Paul Freiberger und Michael Swaine. Anders als die zuletzt erschienen Filme, in denen Steve Jobs eine bedeutende Rolle hat, wird dieser Film aus der Sicht von Steve Wozniak auf Seiten Apples und Steve Ballmer auf Seiten von Microsoft erzählt. Der Film umspannt etwa die Zeit von 1971 bis 1997 und beschreibt den Aufstieg von Steve Jobs und Apple, sowie von Bill Gates und Microsoft.
Fazit
Fans sollten sich „Steve Jobs: The Man In The Machine“ dennoch unbedingt anschauen. Die Dokumentation beinhaltet ein paar noch nicht allzu oft gesehene Aufnahmen, neue Interviews und ein paar neue Anekdoten.
Wer sich einen wirklich guten Film über Steve Jobs anschauen möchte, dem sei nach wie vor „Pirates of Silicon Valley“ mit Noah Wyle als Steve Jobs aus dem Jahr 1999 empfohlen. Inhaltlich endet der Film allerdings naturgemäß deutlich vor dem grandiosen (Wieder-)Aufstieg Apples. Dieser Teil ist aber den meisten ja ohnehin bekannt.